SPD und DGB - da passt nicht mehr viel zusammen
Das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften ist stark abgekühlt / Linkspartei macht Konkurrenz.
[Weinheimer Nachrichten vom 03. April 2007]
Von unserem Korrespondenten Rudi Wais.
Berlin. Nirgendwo zeigt sich die zunehmende Entfremdung zwischen der SPD und den Gewerkschaften besser als im Bundesvorstand des DGB: Die Sozialdemokratin Ursula Engelen-Kefer wurde vergangenes Jahr durch die grüne Fundi-Frau Annelie Buntenbach ersetzt, für den altgedienten Genossen Heinz Putzhammer rückte der Metaller Claus Matecki in die DGB-Spitze auf, ein Sympathisant der Linkspartei - und mit Ingrid Sehrbrock schaffte es auch ein CDU-Mitglied ins Olymp der deutschen Arbeiterbewegung.
Franz Maget, der Vorsitzende der Bayern-SPD, gibt sich deshalb keinen Illusionen hin. Der jüngste Affront, das Wieder-Ausladen von drei Bundestagsabgeordneten der SPD von den Kundgebungen zum 1. Mai, hat für ihn Symbolcharakter: "Das signalisiert, dass man gar nicht mit uns reden will."
Er hat es dann doch noch getan und sich mit dem bayerischen DGB-Boss Fritz Schösser, dem Mann hinter der Entscheidung, zu einem "durchaus angenehmen Gespräch" getroffen. In der Sache sei man zwar nach wie vor weit auseinander. Eskalieren lassen aber, versichert Maget, wollten den Konflikt weder er noch Schösser, der nach wie vor das Parteibuch der SPD besitzt. Die fordernde Art allerdings, mit der die Gewerkschaften neuerdings ihren langjährigen Verbündeten aus der Sozialdemokratie gegenüber auftreten, empört nicht nur Franz Maget: "Man kann von Abgeordneten nicht erwarten, dass sie erst beim DGB anrufen, ehe sie abstimmen." Die SPD müsse zwar Brücken zur Arbeitnehmerbewegung bauen. "Aber sie kann niemals eine Gewerkschaftspartei sein."
Mit dem Erstarken der neuen Linken haben sich die Koordinaten im sozialpolitisch-sozialdemokratischen Biotop spürbar verschoben. Der westdeutsche Teil ihrer Funktionäre, bislang in der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) organisiert, kommt wie Vorstandsmitglied Klaus Ernst aus den Gewerkschaften, und hier vor allem aus der IG Metall. Männer des Apparates wie Ernst haben den Protest gegen Gerhard Schröders Sozialreformen kanalisiert und auch jetzt, da die SPD in der Großen Koalition regiert, regen Zulauf. Die Rente mit 67, die geplanten Steuernachlässe für Unternehmen, die gekürzte Pendlerpauschale: Das Reservoir der Unzufriedenen SPD-Wähler ist groß.
Maget, der im nächsten Jahr eine Landtagswahl zu bestehen hat, erinnert die Situation immer mehr an die des Jahres 2003. Damals, so glaubt er heute, landete er als Spitzenkandidat der SPD nur deshalb bei dürftigen 19,6 Prozent, weil in der Partei ein Mitgliederbegehren gegen Schröders Agenda 2010 lief. Nun, fürchtet er, könnte das Mobilisieren der eigenen Anhänger ähnlich schwer werden - wenn die Gewerkschaften sich offen gegen die Sozialdemokraten stellen. Dass die SPD den Kündigungsschutz verteidigt und die betriebliche Mitbestimmung gesichert hätten, klagt er, gehe in der aufgeheizten Debatte leider allzu oft unter. Der SPD-Sozialexperte Otmar Schreiner formuliert es noch drastischer: Wegen der Linkspartei liefen die Sozialdemokraten Gefahr, "Teile der heimatlos gewordenen Unterschichten an die Konkurrenzpartei zu verlieren". Umso wichtiger ist SPD-Chef Kurt Beck und Arbeitsminister Franz Müntefering nun ein gesetzlicher Mindestlohn als Signal an die Gewerkschaften. Dessen Einführung, ahnt Schreiner, "ist die Nagelprobe."
Im Moment allerdings bewegen sich beide Seiten eher voneinander weg als aufeinander zu. Der Aufstieg der Grünen Buntenbach in den DGB-Vorstand wurde intern auch als Zeichen gewertet, dass die Gewerkschaften näher an Organisationen wie die Globalisierungskritiker von Attac heranrücken wollen. Dass ein Mann wie der frühere Sozialminister Walter Riester, pragmatisch und auf Ausgleich bedacht, heute noch einmal zweiter Vorsitzender der IG Metall würde, kann auch Riester selbst sich nicht mehr vorstellen. Sein Mentor Schröder hatte, wie er in seinen Memoiren schreibt, schon früh den Eindruck, als seien die Gewerkschaften nur noch auf Konfrontation aus. "Dem IG-Metall-Vorsitzenden Jürgen Peters und dem Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske ging es nicht mehr um Änderungen an Details der Agenda 2010, vielmehr wollten sie das Reformprogramm als solches und damit verbunden mich als Bundeskanzler zu Fall bringen."
[Weinheimer Nachrichten vom 03. April 2007]
Von unserem Korrespondenten Rudi Wais.
Berlin. Nirgendwo zeigt sich die zunehmende Entfremdung zwischen der SPD und den Gewerkschaften besser als im Bundesvorstand des DGB: Die Sozialdemokratin Ursula Engelen-Kefer wurde vergangenes Jahr durch die grüne Fundi-Frau Annelie Buntenbach ersetzt, für den altgedienten Genossen Heinz Putzhammer rückte der Metaller Claus Matecki in die DGB-Spitze auf, ein Sympathisant der Linkspartei - und mit Ingrid Sehrbrock schaffte es auch ein CDU-Mitglied ins Olymp der deutschen Arbeiterbewegung.
Franz Maget, der Vorsitzende der Bayern-SPD, gibt sich deshalb keinen Illusionen hin. Der jüngste Affront, das Wieder-Ausladen von drei Bundestagsabgeordneten der SPD von den Kundgebungen zum 1. Mai, hat für ihn Symbolcharakter: "Das signalisiert, dass man gar nicht mit uns reden will."
Er hat es dann doch noch getan und sich mit dem bayerischen DGB-Boss Fritz Schösser, dem Mann hinter der Entscheidung, zu einem "durchaus angenehmen Gespräch" getroffen. In der Sache sei man zwar nach wie vor weit auseinander. Eskalieren lassen aber, versichert Maget, wollten den Konflikt weder er noch Schösser, der nach wie vor das Parteibuch der SPD besitzt. Die fordernde Art allerdings, mit der die Gewerkschaften neuerdings ihren langjährigen Verbündeten aus der Sozialdemokratie gegenüber auftreten, empört nicht nur Franz Maget: "Man kann von Abgeordneten nicht erwarten, dass sie erst beim DGB anrufen, ehe sie abstimmen." Die SPD müsse zwar Brücken zur Arbeitnehmerbewegung bauen. "Aber sie kann niemals eine Gewerkschaftspartei sein."
Mit dem Erstarken der neuen Linken haben sich die Koordinaten im sozialpolitisch-sozialdemokratischen Biotop spürbar verschoben. Der westdeutsche Teil ihrer Funktionäre, bislang in der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) organisiert, kommt wie Vorstandsmitglied Klaus Ernst aus den Gewerkschaften, und hier vor allem aus der IG Metall. Männer des Apparates wie Ernst haben den Protest gegen Gerhard Schröders Sozialreformen kanalisiert und auch jetzt, da die SPD in der Großen Koalition regiert, regen Zulauf. Die Rente mit 67, die geplanten Steuernachlässe für Unternehmen, die gekürzte Pendlerpauschale: Das Reservoir der Unzufriedenen SPD-Wähler ist groß.
Maget, der im nächsten Jahr eine Landtagswahl zu bestehen hat, erinnert die Situation immer mehr an die des Jahres 2003. Damals, so glaubt er heute, landete er als Spitzenkandidat der SPD nur deshalb bei dürftigen 19,6 Prozent, weil in der Partei ein Mitgliederbegehren gegen Schröders Agenda 2010 lief. Nun, fürchtet er, könnte das Mobilisieren der eigenen Anhänger ähnlich schwer werden - wenn die Gewerkschaften sich offen gegen die Sozialdemokraten stellen. Dass die SPD den Kündigungsschutz verteidigt und die betriebliche Mitbestimmung gesichert hätten, klagt er, gehe in der aufgeheizten Debatte leider allzu oft unter. Der SPD-Sozialexperte Otmar Schreiner formuliert es noch drastischer: Wegen der Linkspartei liefen die Sozialdemokraten Gefahr, "Teile der heimatlos gewordenen Unterschichten an die Konkurrenzpartei zu verlieren". Umso wichtiger ist SPD-Chef Kurt Beck und Arbeitsminister Franz Müntefering nun ein gesetzlicher Mindestlohn als Signal an die Gewerkschaften. Dessen Einführung, ahnt Schreiner, "ist die Nagelprobe."
Im Moment allerdings bewegen sich beide Seiten eher voneinander weg als aufeinander zu. Der Aufstieg der Grünen Buntenbach in den DGB-Vorstand wurde intern auch als Zeichen gewertet, dass die Gewerkschaften näher an Organisationen wie die Globalisierungskritiker von Attac heranrücken wollen. Dass ein Mann wie der frühere Sozialminister Walter Riester, pragmatisch und auf Ausgleich bedacht, heute noch einmal zweiter Vorsitzender der IG Metall würde, kann auch Riester selbst sich nicht mehr vorstellen. Sein Mentor Schröder hatte, wie er in seinen Memoiren schreibt, schon früh den Eindruck, als seien die Gewerkschaften nur noch auf Konfrontation aus. "Dem IG-Metall-Vorsitzenden Jürgen Peters und dem Verdi-Vorsitzenden Frank Bsirske ging es nicht mehr um Änderungen an Details der Agenda 2010, vielmehr wollten sie das Reformprogramm als solches und damit verbunden mich als Bundeskanzler zu Fall bringen."
labudda - 4. Apr, 19:41
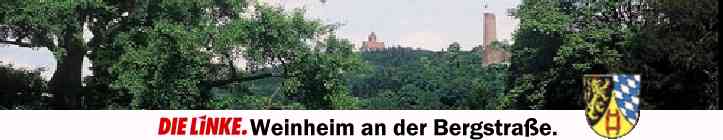
Trackback URL:
https://linksparteiweinheim.twoday.net/stories/3527196/modTrackback