Reflexhafte Debatte über das Tabu-Thema Unterschicht
[Weinheimer Nachrichten vom 18. Oktober 2006]
Regierung, Sozialverbände, Opposition - jeder interpretiert die neue Armutsstudie, wie es ihm ins Konzept passt.
So erschreckend die Zahlen sind, so reflexhaft reagiert die Politik auf die neue Unterschicht-Debatte. Sind die Hartz-Gesetze dafür verantwortlich, dass sich acht Prozent der Menschen in Deutschland auf der Verliererseite wähnen? Ist die Armut in den sieben Jahren, die Rot-Grün regiert hat, gestiegen? Kann ein gesetzlicher Mindestlohn die Not lindern? Ob Regierung, Sozialverbände oder Opposition: Jeder interpretiert die Ergebnisse so, wie es ihm gerade ins Konzept passt. Die einen, allen voran die Gewerkschaften und die Linkspartei, fordern ein höheres Arbeitslosengeld II. Die anderen, allen voran die Regierungsparteien, reden von besserer Bildung - die aber Ländersache ist. Und einige wenige, allen voran CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer, halten die neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung für längst nicht so brisant wie die aufgeregten Stellungnahmen es vermuten lassen. "Soziologenkauderwelsch" sei das, sagt Ramsauer. Das finde er "unerträglich."
Tatsächlich rührt die Diskussion an einem deutschen Tabu. Seit Ludwig Erhard vor fast 50 Jahren "Wohlstand für alle" im Wirtschaftswunderland versprach, war Armut offiziell kein Thema in der Bundesrepublik, und in der DDR schon gar nicht. Sozialforscher sprachen von einer Aufstiegsgesellschaft - einer Gesellschaft, in der nicht alle reich waren, in der aber (fast) alle sicher sein konnten, dass sie in zehn Jahren mehr besitzen würden als heute. Die meisten anderen fing ein eng geknüpftes soziales Netz auf. Erst mit Beginn der letzten Wirtschaftskrise um den Jahrtausendwechsel herum und den ersten tieferen Einschnitten in dieses Netz wurden die Verwerfungen deutlicher. Gegenwärtig gelten gut 13 Millionen Menschen in Ost und West als arm, weil sie nicht einmal 60 Prozent eines durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Mehr als drei Millionen Haushalte sind teilweise heillos überschuldet.
Statistisch betrachtet ist jeder Mensch in Deutschland arm, der weniger als 938 Euro im Monat zur Verfügung hat - und das sind nicht nur Niedriglöhner, Sozialhilfeempfänger oder allein erziehende Mütter. Zur neuen Unterschicht der Besitzlosen zählen auch jäh gescheiterte Anwälte, Architekten oder Ingenieure. "Die einen sind tief gefallen", beobachtete die Wochenzeitung "Die Zeit" schon vor mehr als einem Jahr, "die anderen nie aufgestiegen." Mit der umstrittenen Fusion von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II, warnen Experten, habe das nichts zu tun. Bildungsarmut und Langzeitarbeitslosigkeit seien in Deutschland so alt, "dass Hartz IV keine Rolle spielen kann", sagt der Sozialexperte der Evangelischen Kirche, Gert Wagner. "Wir schicken 20 Prozent eines Jahrganges ohne verwertbaren Schulabschluss ins Leben. Denen droht lebenslange Armut."
So unversehens, wie es im Moment den Anschein hat, trifft die Debatte die Politik nicht. Bereits in den 70er Jahren hatte der damalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler die "neue soziale Frage" thematisiert - allerdings ohne Erfolg. Der PISA-Schock vor drei Jahren führte dann auch der amtierenden Politikergeneration Deutschlands Defizite drastisch vor Augen: Kinder aus benachteiligten Familien haben im gegenwärtigen Bildungssystem kaum Aufstiegschancen, ihnen sind Arbeitslosigkeit und Armut gewissermaßen in die Wiege gelegt. Auch die Fälle von Verwahrlosung, von denen der Tod des kleinen Kevin in Bremen nur ein besonders drastischer war, würden zu 99 Prozent in armen Familien registriert, moniert der Kinderschutzbund.
Die Politik allerdings sucht erst noch nach dem richtigen Begriff für das Phänomen der sozialen Ausgrenzung. Soll sie, soziologisch korrekt, von einem "abgehängten Prekariat" reden? Oder, deutlich pointierter, von der Unterschicht? Oder, etwas unverfänglicher, von der "neuen Armut"? Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) sagt es so: "Wir leben in einer Klassengesellschaft." Soziale Gegensätze hätten sich über Generationen hinweg verfestigt. Vor allem für seine Partei ist die Diskussion gefährlich: Sie hat in der Gruppe der Benachteiligten noch das größte Wählerreservoir. Mittlerweile jedoch laufen die SPD-Sympathisanten im Prekariat in Scharen zur Linkspartei über.
Rudi Wais (Berlin)
Regierung, Sozialverbände, Opposition - jeder interpretiert die neue Armutsstudie, wie es ihm ins Konzept passt.
So erschreckend die Zahlen sind, so reflexhaft reagiert die Politik auf die neue Unterschicht-Debatte. Sind die Hartz-Gesetze dafür verantwortlich, dass sich acht Prozent der Menschen in Deutschland auf der Verliererseite wähnen? Ist die Armut in den sieben Jahren, die Rot-Grün regiert hat, gestiegen? Kann ein gesetzlicher Mindestlohn die Not lindern? Ob Regierung, Sozialverbände oder Opposition: Jeder interpretiert die Ergebnisse so, wie es ihm gerade ins Konzept passt. Die einen, allen voran die Gewerkschaften und die Linkspartei, fordern ein höheres Arbeitslosengeld II. Die anderen, allen voran die Regierungsparteien, reden von besserer Bildung - die aber Ländersache ist. Und einige wenige, allen voran CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer, halten die neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung für längst nicht so brisant wie die aufgeregten Stellungnahmen es vermuten lassen. "Soziologenkauderwelsch" sei das, sagt Ramsauer. Das finde er "unerträglich."
Tatsächlich rührt die Diskussion an einem deutschen Tabu. Seit Ludwig Erhard vor fast 50 Jahren "Wohlstand für alle" im Wirtschaftswunderland versprach, war Armut offiziell kein Thema in der Bundesrepublik, und in der DDR schon gar nicht. Sozialforscher sprachen von einer Aufstiegsgesellschaft - einer Gesellschaft, in der nicht alle reich waren, in der aber (fast) alle sicher sein konnten, dass sie in zehn Jahren mehr besitzen würden als heute. Die meisten anderen fing ein eng geknüpftes soziales Netz auf. Erst mit Beginn der letzten Wirtschaftskrise um den Jahrtausendwechsel herum und den ersten tieferen Einschnitten in dieses Netz wurden die Verwerfungen deutlicher. Gegenwärtig gelten gut 13 Millionen Menschen in Ost und West als arm, weil sie nicht einmal 60 Prozent eines durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Mehr als drei Millionen Haushalte sind teilweise heillos überschuldet.
Statistisch betrachtet ist jeder Mensch in Deutschland arm, der weniger als 938 Euro im Monat zur Verfügung hat - und das sind nicht nur Niedriglöhner, Sozialhilfeempfänger oder allein erziehende Mütter. Zur neuen Unterschicht der Besitzlosen zählen auch jäh gescheiterte Anwälte, Architekten oder Ingenieure. "Die einen sind tief gefallen", beobachtete die Wochenzeitung "Die Zeit" schon vor mehr als einem Jahr, "die anderen nie aufgestiegen." Mit der umstrittenen Fusion von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II, warnen Experten, habe das nichts zu tun. Bildungsarmut und Langzeitarbeitslosigkeit seien in Deutschland so alt, "dass Hartz IV keine Rolle spielen kann", sagt der Sozialexperte der Evangelischen Kirche, Gert Wagner. "Wir schicken 20 Prozent eines Jahrganges ohne verwertbaren Schulabschluss ins Leben. Denen droht lebenslange Armut."
So unversehens, wie es im Moment den Anschein hat, trifft die Debatte die Politik nicht. Bereits in den 70er Jahren hatte der damalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler die "neue soziale Frage" thematisiert - allerdings ohne Erfolg. Der PISA-Schock vor drei Jahren führte dann auch der amtierenden Politikergeneration Deutschlands Defizite drastisch vor Augen: Kinder aus benachteiligten Familien haben im gegenwärtigen Bildungssystem kaum Aufstiegschancen, ihnen sind Arbeitslosigkeit und Armut gewissermaßen in die Wiege gelegt. Auch die Fälle von Verwahrlosung, von denen der Tod des kleinen Kevin in Bremen nur ein besonders drastischer war, würden zu 99 Prozent in armen Familien registriert, moniert der Kinderschutzbund.
Die Politik allerdings sucht erst noch nach dem richtigen Begriff für das Phänomen der sozialen Ausgrenzung. Soll sie, soziologisch korrekt, von einem "abgehängten Prekariat" reden? Oder, deutlich pointierter, von der Unterschicht? Oder, etwas unverfänglicher, von der "neuen Armut"? Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) sagt es so: "Wir leben in einer Klassengesellschaft." Soziale Gegensätze hätten sich über Generationen hinweg verfestigt. Vor allem für seine Partei ist die Diskussion gefährlich: Sie hat in der Gruppe der Benachteiligten noch das größte Wählerreservoir. Mittlerweile jedoch laufen die SPD-Sympathisanten im Prekariat in Scharen zur Linkspartei über.
Rudi Wais (Berlin)
darkrond - 18. Okt, 17:46
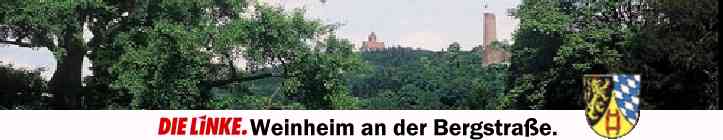
Trackback URL:
https://linksparteiweinheim.twoday.net/stories/2821376/modTrackback